|

Umfrage
zur Arbeitssituation von Ärztinnen und Ärzten in der
Wissenschaft und Forschung an der Universität zu Lübeck
Auswertung
von
Imke Krebs, Sabine Voigt
Lübeck 2004
Im
Frühjahr 2003 wurde von der Medizinischen Fakultät der
Universität zu Lübeck in Zusammenarbeit mit der
Frauenbeauftragten eine Umfrage gestartet, die die Arbeitssituation
in Wissenschaft und Forschung von Ärztinnen und Ärzten
analysieren sollte. Ziel dieser Befragung war, die Hindernisse
während der Promotion und Habilitation von Ärztinnen und
Ärzten zu erfassen und daraus ableitend zukünftige
Maßnahmen zum Abbau möglicher Hürden zu entwickeln
und umzusetzen.
Insgesamt
wurden 711 Personen angeschrieben. Nach einer Erinnerung sind 385
Fragebögen zurückgekommen, was einem Rücklauf von 55%
entspricht.
Von den 380 beantworteten Fragebögen (5 missings), wurden 173
(45,5%) von Frauen und 207 (54,5%) von Männern beantwortet.
Die
Ärztinnen waren mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren um
3,5 Jahre jünger als ihre männlichen Kollegen (38,5).
Beruf
oder Familie ?
Hinsichtlich
des Familienstandes zeigt sich, dass Ärzte häufiger
verheiratet sind (65%) als Ärztinnen (44%). Hier wirkt sich
möglicherweise noch die Tradition aus, dass ein verheirateter
Arzt als belastbarer gilt (die Ehefrau als Entlastungsfaktor für
die Familie), während einer verheirateten Ärztin stets die
Doppelbelastung Beruf und Familie zugeschrieben wird.
Interessant
sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse zur Anzahl der Kinder:
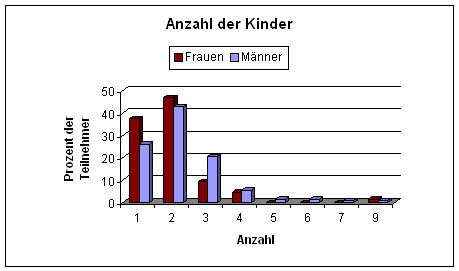
Von
den 173 befragten Frauen haben 109 keine Kinder. Das entspricht einer
Quote von 63%!
Von
den Ärztinnen mit Kindern, haben 38% ein Kind und 45% zwei
Kinder. Interessant wird es bei der Anzahl von drei Kindern: hier
haben Ärzte deutlich häufiger 3 Kinder (20%) als Ärztinnen
(8,5%).
Bei
der Frage, ob ihnen durch die Kinderbetreuung berufliche Nachteile
entstanden sind, haben nahezu 70% aller weiblichen Befragten mit „ja“
geantwortet, während nur 14% der männlichen Befragten diese
Frage bestätigten. Eine weitere Frage zu diesem Themenbereich,
die sich an alle Ärztinnen und Ärzte (mit und ohne Kinder)
richtete, lautete, ob sie glauben, dass ihnen durch Kinder
grundsätzlich berufliche Nachteile entstehen. Hier war das
Antwortverhalten noch deutlicher: 91,9% der Ärztinnen bejahten
die Frage gegenüber 35,1% ihrer männlichen Kollegen.
Dieses
Antwortverhalten könnte auch eine Erklärung für die
geringen Geburtenquoten bei Akademikerinnen sein, insbesondere bei
Wissenschaftlerinnen in den technischen und naturwissenschaftlichen
Fächern.
In
einer anderen bundesweiten Umfrage, die im Frühjahr 2001 bei den
weiblichen Mitgliedern der deutschen Physikalischen Gesellschaft
durchgeführt worden ist, kam heraus, dass von den insgesamt 3062
angeschriebenen Physikerinnen, 71% keine Kinder hatten.
Diese Zahlen belegen sehr eindrucksvoll, zumindest im akademischen
Bereich, die derzeitige Unvereinbarkeit von Beruf und Familie.
Die
berufliche und familiäre Doppelbelastung wird auch bei der Frage
nach Teilzeit- bzw. Vollzeitbeschäftigung deutlich. Nur ein Arzt
(5,4%) gab an, in Teilzeit beschäftigt zu sein gegenüber 52
der befragten Ärztinnen (30,6%).
Die Promotion – das ungenutzte
Potential
Ein
weiteres für die Fakultät interessantes Ergebnis ist, dass
65% der Befragten während ihrer Promotion in kein größeres
Forschungsprojekt eingebunden waren. Von den Doktoranden, die in
Forschungsprojekte eingebunden waren, waren doppelt so viele Männer
(84 (43%)) als Frauen (41 (23%)).
An
dieser Stelle muss die Frage gestellt werden, ob hier nicht
wissenschaftliche Kapazitäten vergeudet werden und ob zukünftig
eine effizientere und gezieltere Förderung von Promotionen
innerhalb von Forschungsprojekten nicht sowohl wissenschaftlich als
auch betriebswirtschaftlich sinnvoller wäre. Darüber hinaus
waren 25% mit der Betreuung der Promotion nicht zufrieden.
Insbesondere zu lange Korrekturzeiten, die die Doktorarbeiten unnötig
verzögerten, wurden hier als freie Antwortmöglichkeit am
häufigsten angegeben. Vor dem Hintergrund des neuen
Hochschulrahmengesetzes, das für die Fertigstellung einer
Doktorarbeit sehr klare Zeitvorgaben angibt, erscheint auch in diesem
Punkt ein dringender Handlungsbedarf. Hierbei könnte die neue
Promotionsordnung der Medizinischen Fakultät ein erster Schritt
hin zu einer effizienteren Nutzung der wissenschaftlichen Ergebnisse
von Promotionen sein.
Die Habilitation – ein
Auslaufmodell?
Was
sich bei der (Nicht)Einbindung der Promotion in Forschungsvorhaben
bereits ankündigt, setzt sich beim Antwortverhalten zur
Habilitation fort. Denn hier trennen sich die Wege der Ärztinnen
und Ärzte. Lediglich 13,5 % der Ärztinnen wollen sich
habilitieren, während sich 42% der Ärzte die Habilitation
anstreben. Allerdings zeigen die Antworten sowohl bei den Frauen als
auch bei den Männern Unsicherheiten: 37% der Ärztinnen und
35% der Ärzte haben die Frage, ob sie sich habilitieren wollen,
mit „vielleicht“ beantwortet. Mit anderen Worten, hier
ruht eine wissenschaftliches Potential, dass es noch zu motivieren
gilt.
Setzt
man diese Ergebnisse mit den Antworten zur Promotion ins Verhältnis,
dann ist zu vermuten, dass die Ärztinnen und Ärzte, die
bereits während der Promotion in eine Forschergruppe integriert
waren, auch motiviert sind, weiterhin wissenschaftlich zu arbeiten,
um schließlich zu habilitieren. Da Männer als Doktoranden
doppelt so häufig in Projekte eingebunden waren als Frauen,
verwundert die bisher noch geringe Habilitationsquote von Frauen
nicht.
Außerdem
ist auffällig, dass lediglich 26,5% aller Befragten angegeben
haben, ihre Habilitation habe einen inhaltlichen und/oder
methodischen Bezug zu der vorangegangenen Promotion. Deutlicher
ausgedrückt, 73,5% der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
haben sich mit Beginn ihrer Habilitation in ein völlig
inhaltlich und methodisch neues Gebiet eingearbeitet, und sich
praktisch erst zu diesem Zeitpunkt für ihren zukünftigen
wissenschaftlichen Schwerpunkt entschieden. Hierbei haben
geschlechtsspezifische Unterschiede im übrigen kaum eine
Bedeutung. Die Promotion in der Medizin spielt offensichtlich für
die zukünftige wissenschaftliche Spezialisierung und Laufbahn
eine äußerst geringe Rolle. Damit entscheiden sich
deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf dem Gebiet der
Medizin im internationalen Vergleich sehr spät für ein
wissenschaftliches Schwerpunktthema.
Ähnlich
wie bei der Promotion stellt sich der Zufriedenheitsfaktor beim
Verlauf der Habilitation dar. 28% waren damit unzufrieden und die
Gründe liegen hauptsächlich in der mangelnden Zeit, die
neben Krankenversorgung und Lehre kaum mehr Raum für Forschung
zulässt und in zu geringer Unterstützung. Dabei waren die
Wissenschaftlerinnen wesentlich unzufriedener als ihre männlichen
Kollegen, denn fast die Hälfte aller Habilitandinnen gaben an,
mit dem Verlauf der Habilitation unzufrieden zu sein.
So
ist es auch kaum verwunderlich, dass sich 56% der
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht während der
regulären Arbeitszeit ihrer Habilitation widmen konnten. Das
unter diesen Umständen Forschungsarbeiten nur zögerlich
vorankommen, erstaunt wenig. Doch dieses Phänomen betrifft nicht
nur Lübeck, sondern alle Medizinischen Fakultäten. Eine
Entzerrung des Dreiergestirns Forschung, Lehre und Krankenversorgung
könnte hier Lösungsansätze bieten, um in der Forschung
mittel- und langfristig auch der internationalen Konkurrenz stand zu
halten.
Denn
die interne Verteilung in Routinearbeit sprich Krankenversorgung auf
der einen Seite und Forschung auf der anderen ist nach Meinung von
90% der Befragten ohnehin nicht gleich verteilt. Das heißt,
inoffiziell scheint es bereits eine Aufgliederung des
wissenschaftlichen Personals für erstens Krankenversorgung und
zweitens Forschung zu geben. Und diese Aufgliederung, da sind sich
Männer und Frauen einig, ist geschlechtsspezifisch, denn 62%
meinten, dass Männer mehr Arbeitszeit für Forschung bei
gleicher Qualifikationsstufe investieren als in Krankenversorgung.
In
diese Richtung weisen auch die Antworten auf die Frage nach den
Voraussetzungen für eine wissenschaftliche Weiterqualifikation.
Hier gibt die überwiegende Mehrheit, nämlich 69%, eine
Freistellung von Routineaufgaben an. Auch in der Förderung durch
den Vorgesetzten sehen 60% eine wesentliche Voraussetzung für
eine wissenschaftliche Karriere. Ebenso beurteilen 51% längerfristige
Arbeitsverträge als einen Garanten für eine
wissenschaftliche Qualifikation, denn Verträge über
lediglich ein oder zwei Jahre bieten weder Planungssicherheit noch
Kontinuität für ein größeres Forschungsvorhaben.
Auf
die frei zu beantwortende Frage, welche Anforderungen die
Teilnehmenden an die Universität stellen würden, wenn sie
heute noch einmal promovieren bzw. habilitieren würden, ist das
Antwortverhalten eindeutig: Insbesondere für Promotionsarbeiten
wünschte sich die Mehrheit eine bessere Betreuung
(Qualitätsstandards) und klarere Strukturen. Ebenso eine bessere
Vermittlung von statistischen Grundlagen war ein häufig
genanntes Item. Einige beklagten auch den Umstand, dass die Promotion
in der Medizin in der Regel bereits neben dem Studium geschrieben
werde, was in den Augen vieler Befragter geradezu eine Abwertung der
Promotion sei. Um die Promotion wissenschaftlich aufzuwerten, seien,
wie auch in anderen Fächern üblich, Promotionszeiten nach
dem Studium einzurichten, während der man sich intensiv der
wissenschaftlichen Arbeit widmen könne.
Die
Juniorprofessur stößt bei den Befragten auf wenig
Akzeptanz. Die Mehrheit (71,2%) lehnte die Juniorprofessur als
Alternative zur Habilitation ab. Dabei zeigten sich die Ärztinnen
jedoch etwas aufgeschlossener: Immerhin konnten sich knapp 40% der
Ärztinnen eine Juniorprofessur als Alternative zur Habilitation
vorstellen gegenüber nur 24,7% der Ärzte.
Wissenschaftlerinnen und Ärztinnen
– noch nicht entdeckte Potentiale
Die
geringe Habilitationsquote bei den Ärztinnen spiegelt sich auch
in den sonstigen Forschungsaktivitäten wieder.
Hierbei
spielen beispielsweise die Besuche von Fachkongressen eine besondere
Rolle. Zwar besuchen Frauen wie Männer nahezu ähnlich oft
Kongresse, jedoch treten Männer wesentlich häufiger als
Referenten (71%) auf als Frauen (53%). Und diese Vortragshäufigkeit
steht in unmittelbarem Zusammenhang mit Publikationsaktivitäten.
Während
70,7% der befragten Ärzte in den vergangenen 2 Jahren publiziert
haben (Originalarbeiten), konnten hier nur 44,2% der Ärztinnen
die Frage mit ja beantworten. Auch bei der Antragstellung von
Drittmitteln ist die Quote bei den Männer mit 47,3% deutlich
höher als bei den Frauen (17,5%).
Die
Gründe hierfür reichen von mangelnder Unterstützung
bzw. Freistellung von der Krankenversorgung bis hin zum mangelnden
Interesse am wissenschaftlichen Arbeiten (26%). Gerade das Verfassen
von Publikationen oder Anträgen scheint für viele
problematisch (17%), da hierfür Zeit und vor allem Ruhe benötigt
wird, die im Klinikalltag so nicht vorhanden ist. Ist der private
Alltag dann noch von Kinderbetreuung geprägt, ist es
insbesondere für Ärztinnen schwer, sich weiterhin in der
Forschung zu engagieren. Unflexible Kinderbetreuungszeiten und zu
wenig Hort- und Krippenplätze tun ihr übriges. Nichts Neues
also!
Doch
nun gibt es Bestrebungen seitens der Medizinischen Fakultät,
zumindest Ärztinnen, die den Spagat zwischen Lehre,
Krankenversorgung und Forschung auf der einen Seite und Familie auf
der anderen zu erleichtern. Seit vergangenem Jahr wird über die
interne Forschungsförderung der Medizinischen Fakultät ein
Programm angeboten, dass sich zunächst speziell an Ärztinnen
mit Kindern richtet. Sie haben die Möglichkeit auf Antrag eine
6-12monatige Freistellung von der Krankenversorgung zu bekommen, um
ihr Habilitationsvorhaben zu beenden.
Nach Auswertung der Befragung ein lohnenswertes und von vielen
Befragten durchaus gefordertes Programm. Zumindest war es eine
wiederholt geäußerte Antwort auf die frei zu beantwortende
Fragen, welche Anregungen und Wünsche sie denn hätten, um
den Frauenanteil in der Wissenschaft und Forschung zu steigern.
Zusammenfassung
und Ausblick
Hinsichtlich
der Unvereinbarkeit von wissenschaftlicher Karriere und Familie hat
die Umfrage an der Universität zu Lübeck letztlich die
Ergebnisse von ähnlichen Umfragen in Göttingen
und Berlin
bestätigt. Noch immer lasten mehrheitlich die familiären
Verpflichtungen auf den Schultern der Frauen, was sich insbesondere
während der medizinischen Weiterbildung und der
wissenschaftlichen Qualifizierungsphase ungünstig auf die
Karriereverläufe von Ärztinnen auswirkt. Und die meisten
Ärztinnen haben nach der vorliegenden Umfrage ihre Kinder
während der Facharztweiterbildung bekommen. Mangelnde
Kinderbetreuung und unflexible Öffnungszeiten der
Kinderbetreuungseinrichtungen erschweren nach Angaben der Befragten
entscheidend die weitere berufliche Entwicklung von Frauen. Dies wird
auch geradezu gebetsmühlenartig von bundesweiten Studien immer
wieder bestätigt. Trotz dieser erwiesenen Defizite erscheinen
politische Entscheidungen und vor allem deren Umsetzungen in weiter
Ferne. Allein immer wieder beschworene Absichtserklärungen
seitens des Bundesfamilienministeriums reichen eben nicht, um in
dieser Frage eine Trendwende einzuläuten.
Vor
diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll und richtig, dass die
Universität zu Lübeck zumindest bei der Nachwuchsförderung
einen Schwerpunkt auf die Qualifizierung von wissenschaftlich
engagierten Ärztinnen mit Kindern gesetzt hat.
Ein
weiteres wichtiges Ergebnis dieser Umfrage ist die viel zu geringe
Einbindung von Doktoranden insbesondere von Doktorandinnen in
Forschungsprojekte. Dabei hätte die stärkere Nutzung von
Promotionen für Forschungsschwerpunkte für alle Beteiligten
nur Vorteile:
Eine
intensivere Einbindung von DoktorandInnen hat in der Regel eine
bessere Betreuung zur Folge.
Die
zielgerichtete Einsetzung von Promotionsthemen bedeutet einen
zielgerichteten Einsatz von Materialien (z.B. Reagenzien, Rohstoffe
etc.) und ist damit kostensparend.
Ist
eine Promotion teil eines Forschungsprojektes, erhöht dies in
der Regel auch die Qualität der Promotionsarbeit.
Für
wissenschaftlich engagierte DoktorandInnen eröffnet sich früher
die Möglichkeit, für sich einen wissenschaftlichen
Schwerpunkt zu definieren und diesen kontinuierlich für eine
Habilitation auszubauen. Eine frühe wissenschaftliche
Profilierung würde sich insbesondere für Frauen günstig
auf den Karriereverlauf auswirken.
Wissenschaftliche
Kontinuität ist schließlich auch eine der Voraussetzungen
für wissenschaftliche Spitzenleistungen.
Mit
der Etablierung der neuen Promotionsordnung ist sicherlich ein
erster, wichtiger Schritt getan worden, sich dieser Problematik
anzunehmen.
Für
die weitere wissenschaftliche Qualifizierung war für die meisten
Befragten die Freistellung von der Krankenversorgung die wichtigste
Voraussetzung und zwar sowohl für Ärzte als auch für
Ärztinnen. Ein Vorschlag einer Befragten war, ein verbindliches
Curriculum für wissenschaftlich engagierte Ärzte und
Ärztinnen zu erstellen, in dem Freistellungen von der
Krankenversorgung geregelt werden.
Anhang:
Allgemeine Fragen
Für wie
wichtig halten Sie folgende Aspekte für Ihre Arbeit?
(Angaben in
Prozent)
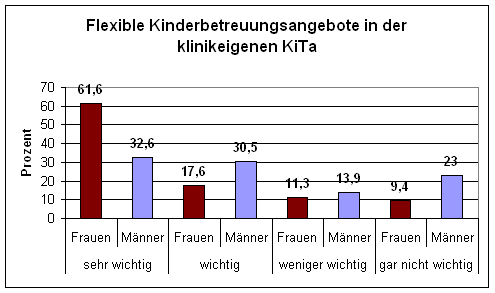
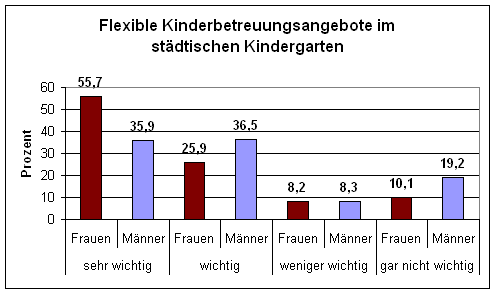
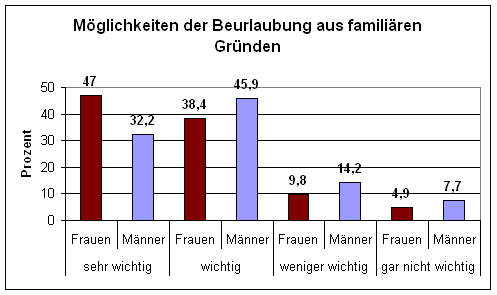
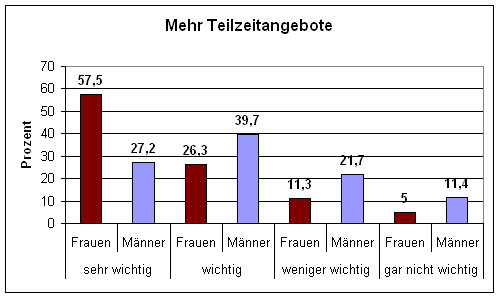
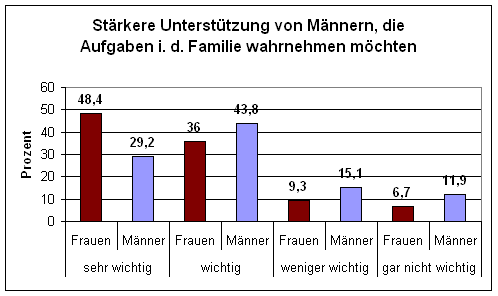
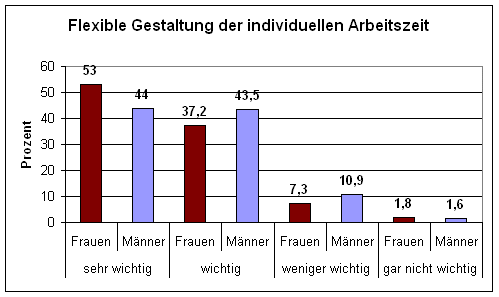
An der Medizinischen Fakultät/Klinikum sind Frauen
in den gehobenen/leitenden Positionen unterrepräsentiert. Welche
Gründe kämen Ihrerseits hierfür in Frage [Angaben
in Prozent]?
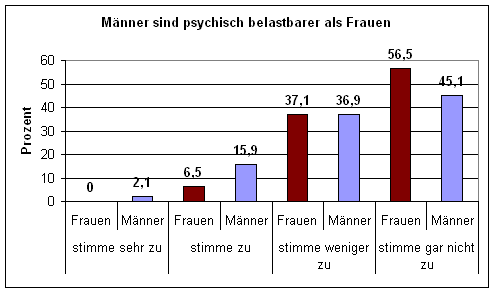
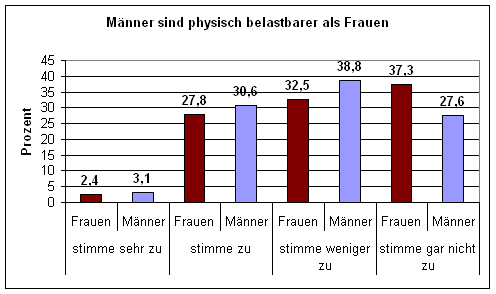
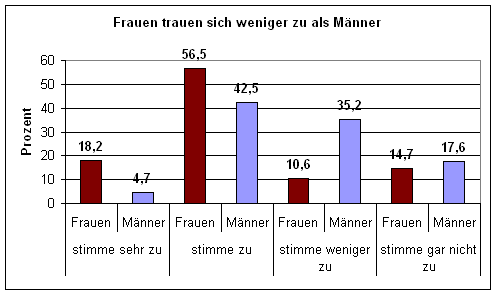
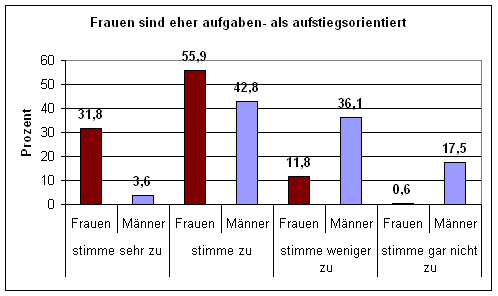
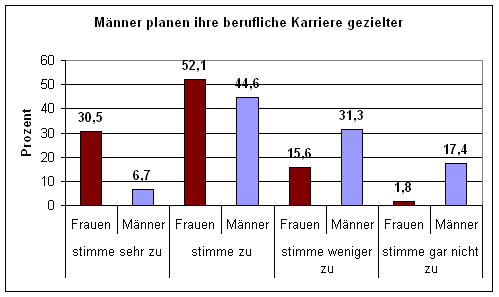
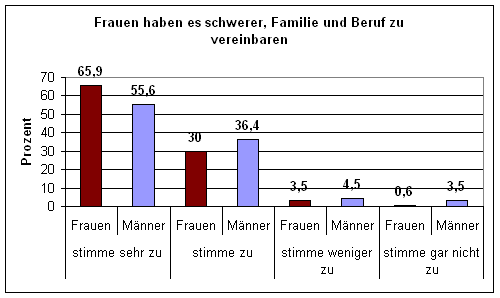
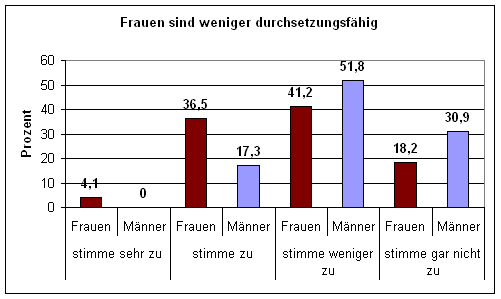
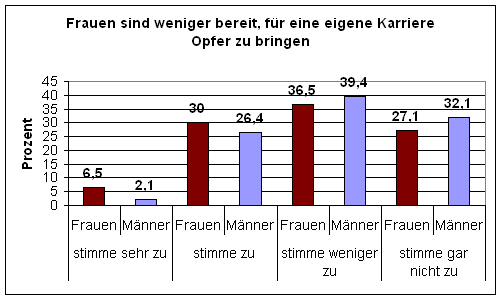
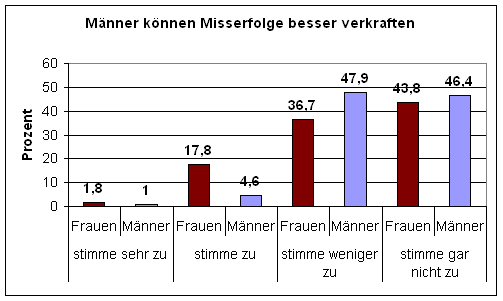
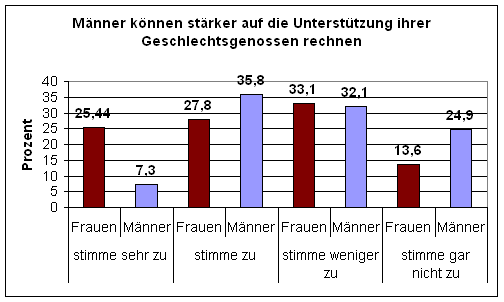
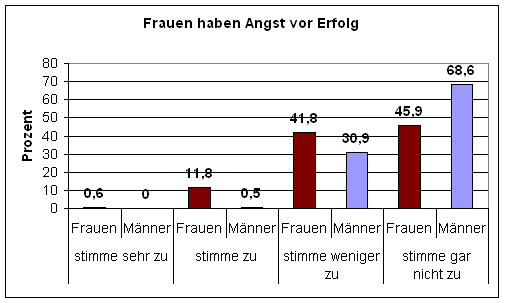
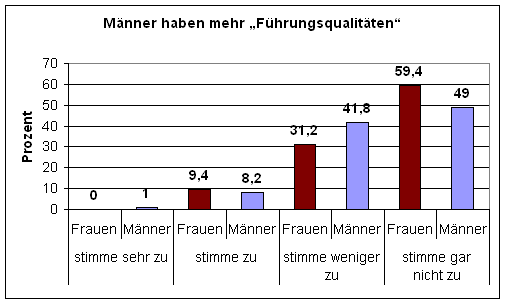
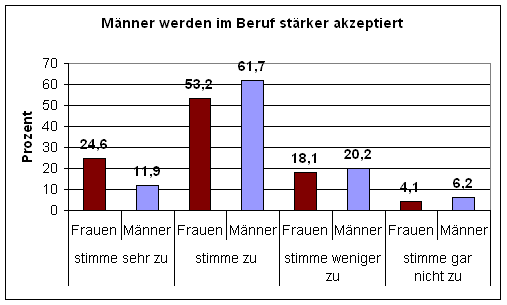
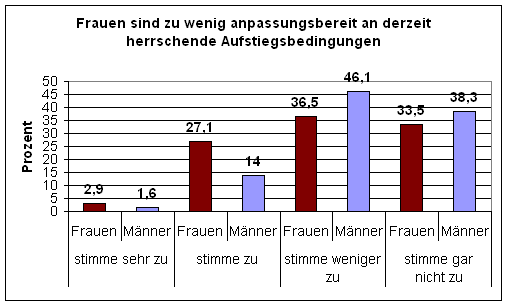
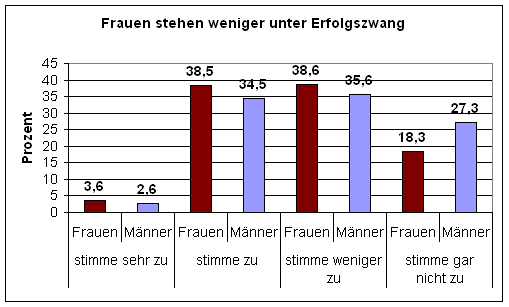
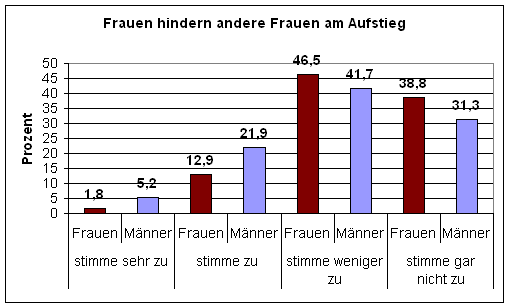
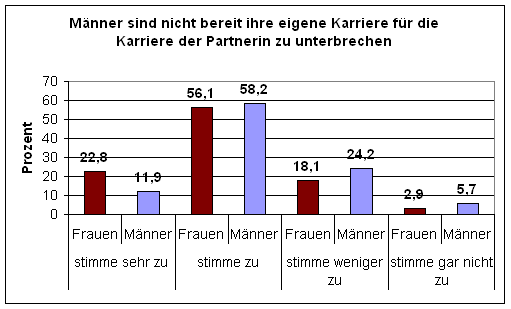
|