|
Halbjahreszeitschrift, Heft 19, März 2004
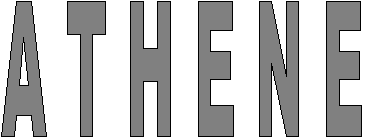
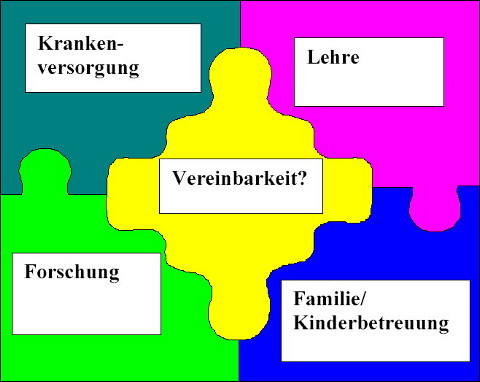
Frauen - Medizin - Wissenschaft - Information
an der UzL
I n h a l t
- Editorial
- Beiträge
- Aktuelles aus der UzL
- News
Editorial
Beim
diesjährigen Jahresempfang fragte die Ministerin für
Bildung, Wissenschaft Forschung und Kultur, Frau Erdsiek-Rave, warum
nicht genauso viele Frauen habilitieren wie promovieren. Die Antwort
findet sie in der Auswertung unserer Umfrage zur Arbeitssituation von
Ärztinnen und Ärzten in Wissenschaft und Forschung, die
jetzt vorliegt.
Und
zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Kinderbetreuung
bringt die vorliegende Untersuchung in der Tat nichts Neues, sondern
bestätigt nur vergleichbare Studien. Noch immer fehlt es an
Kinderbetreuung, insbesondere an Krippen- und Hortplätzen. Da
die Hauptlast der Familienarbeit, wie gehabt, auf den Schultern der
Frauen ruht, ist die geringe Habilitationsquote von Frauen kaum
verwunderlich.
Das
Thema Kinderbetreuung ist zu einem Dauerbrenner geworden. Zunächst
als typisches „Frauenthema“ abgetan, hat sich nunmehr die
Qualität der Diskussion darüber verändert: Spätestens
die Auswertung der Hamburg-Wahl hat die politische Dimension dieses
Themas deutlich gemacht: Kinderbetreuung und Schulbildung rangierten
bei den Wählerinnen und Wählern unter den 5 wichtigsten
gesellschaftspolitischen Themen.
Trotz
dieser neuen Gewichtung und trotz inzwischen unzählbarer
Studien, die die gesellschaftliche Bedeutung von Kinderbetreuung und
Bildung unter den unterschiedlichsten Fragestellungen untersucht
haben, scheint eine sichtbare Trendwende nicht greifen zu wollen.
Alle
Politikerinnen und Politiker reden zwar von verstärkten
Anstrengungen in diesem Bereich, jedoch umgesetzt wird eher das
Gegenteil: die desolaten Haushalte der Gemeinden und Städte
ermutigen diese kaum, neue Betreuungseinrichtungen für Kinder zu
etablieren oder bereits bestehende zu erweitern. Selbst die dringend
notwendige Renovierung von Schulen und ihrer Ausstattung scheint auf
einmal nicht mehr so wichtig zu sein. Schulbücher sind völlig
veraltet und in den Labors, wenn es sie denn gibt, sind aktuelle
naturwissenschaftliche Versuche nicht mehr durchführbar.
Vor
diesem Hintergrund erscheint die Diskussion um die Errichtung von
Elitehochschulen geradezu zynisch.
Bleibt
die Frage: Woher soll die sogenannte Elite eigentlich kommen?
Lübeck
im März 2004
Sabine
Voigt
Beiträge
Studie: "Perspektiven deutscher Wissenschaftlerinnen in der EU Forschungsförderung"
Eine
Zusammenfassung
Von
C.Färber, K. Babbe-Voßbeck u.a.
Die
Studie wurde im Auftrag der Kontaktstelle "Frauen in die
EU-Forschung" im EU-Büro des BMBF erstellt und befasst sich
detailliert mit den Gründen für die geringe Beteiligung
deutscher Wissenschaftlerinnen an den Forschungsrahmenprogrammen der
EU, insbesondere dem 5. Rahmenprogramm der EU.
Frauen
in der Wissenschaft sind in Deutschland im Vergleich zu anderen
EU-Ländern stark unterrepräsentiert. Eine Feinanalyse
zeigt, dass Fächer mit einer hohen Berücksichtigung in der
EU-Forschung eine besonders geringe Repräsentanz von Frauen
aufweisen. Wissenschaftlerinnen erreichen höhere Anteile in
schlechter ausgestatteten und mit weniger Forschungskapazität
versehenen Stellen, z.B. sind sie als Professorinnen an
Fachhochschulen höher repräsentiert als an Universitäten
oder Forschungsinstituten. Von besonderer Relevanz für die
Handlungsmöglichkeiten ist es, dass die qualifizierten
Potenziale von Frauen in Deutschland auf den höheren
Qualifikationsstufen nicht ausgeschöpft werden. Ferner ist es
bedeutsam, dass es eine erhebliche Diskrepanz zwischen den
Bundesländern gibt: Einige wenige Bundesländer wie Berlin
und Brandenburg erreichen in der Repräsentanz von Frauen
durchaus EU-Standard, andere wie Bayern ziehen den deutschen
Durchschnitt erheblich nach unten. Die Teilstudie zeigt erheblichen
Handlungsbedarf in der Verbesserung der Ausgangslage von
Wissenschaftlerinnen in Deutschland, sowohl bei den planmäßigen
Stellen als auch in der Drittmittelförderung. Auf EU-Ebene
bestand für das 5. Rahmenprogramm noch kein Gender-Monitoring,
das wissenschaftlich Tätige erfasst hat. Die Studie formuliert
Anforderungen an ein zukünftiges Gender-Controlling.
Die
zweite Teilstudie stellt eine teilstandardisierte Fragebogenerhebung
bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Deutschland dar. Die
Auswertung gibt Aufschluss über die wissenschaftlichen und
soziodemographischen Faktoren, die eine EU-Antragstellung und deren
Erfolg beeinflussen. Die Fragebogenerhebung führte in
erheblichem Umfang zu neuen und relevanten Ergebnissen. So ist
festzustellen, dass es Frauen trotz schlechterer struktureller
Ausgangsbedingungen gelingt, in der EU-Forschung mitzuwirken. Daraus
ist abzuleiten, dass sie im deutschen Wissenschaftssystem vielfach
unter Wert beschäftigt sind. Es zeigt sich eine hohe Korrelation
zwischen allgemeiner Drittmittelaktivität und EU-Forschung.
Deutlich wird auch, dass es sich auf Frauen auswirkt, dass die
EU-Forschung fachlich enger auf eingeschränkte Fächer in
den Natur- und Ingenieurwissenschaften zugeschnitten ist als die
nationale Förderung. Besonders aufschlussreich sind die Befunde
zu den soziobiographischen Faktoren: Eine Förderung von
Dual-Career-Couples und von Kinderbetreuung sind für den
deutschen Kontext erforderlich, aber es sind auch EU-Maßnahmen
denkbar.
Deutlich
zeigt sich die zentrale Funktion von Beratung und Netzwerken für
Frauen. Der Bildungshintergrund der Eltern, insbesondere der Mutter,
ist die Variable, die den Antragserfolg von Frauen aus Deutschland in
der EU-Forschung am ehesten erklärt. Dies ist ein positives
Ergebnis für die akademisch gebildeten Mütter, die ihren
Töchtern das kulturelle Kapital vermitteln , sich gegen die
Widrigkeiten des Systems durchzusetzen und ein negativer Befund für
das Wissenschaftssystem, das Herkunft und Habitus über Begabung
und Können stellt.
Teilstudie
3 besteht aus qualitativen Interviews mit erfolgreichen
Antragstellerinnen und Antragstellern. Ziel war es, eventuelle
Probleme oder Hindernisse für das Engagement von Frauen in der
EU-Forschung zu eruieren und Lösungsmöglichkeiten zu
diskutieren. In den Interviews zeigt sich besonders stark, wie
wichtig eine Vereinfachung des Antragverfahrens bei der EU ist. Dies
gilt auch für die Informationen, insbesondere für die
Verbesserung der elektronisch verfügbaren Informationen.
Deutlich wird auch der Bedarf nach spezifischer, individueller
Beratung und nach besonderen Unterstützungs- und
Empowerment-Maßnahmen für Frauen.
Aus
den Ergebnissen der drei Teilstudien wird ein Katalog von 25
Handlungsmöglichkeiten abgeleitet, die auf die Europäische
Union, den Bund, die Länder und die Wissenschaftsorganisationen
als Akteurinnen und Akteure abzielen. Die Forderungen gliedern sich
in fünf Handlungsfelder: Die Antragsverfahren in der
EU-Forschung, die Gestaltung der EU-Forschungsprogramme, spezifische
Gleichstellungsmaßnahmen in der EU-Forschung,
Gleichstellungsanforderungen an das deutsche Wissenschaftssystem und
die Gestaltung der Information und Beratung zur EU-Forschung für
deutsche Wisssenschaftlerinnen:
25
Vorschläge für 5 Adressatengruppen zur Gleichstellung von
Frauen in den Forschungsprogrammen der Europäischen
Union
Gestaltung der Antragsverfahren in der
EU-Forschung
1. Weniger aufwändige
Antragsverfahren
2. Übersichtlichere, transparentere
Antragsverfahren
3. Mehr Gewicht auf Wissenschaft und Inhalt
4.
Geschlechterblinde Gutachten
Gestaltung der
EU-Forschungsprogramme
5. Mehr Forschungsmittel für
geistes- und sozialwissenschaftliche Themen
6. Weniger Programm,
mehr Offenheit für einen Teil der Rahmenprogramme; klare
Aufträge in der Auftragsforschung
7. Weniger Quantität,
mehr Qualität in der Kooperation
Gleichstellungsmaßnahmen
in der EU-Forschung
8. Gender-Monitoring in der
EU-Forschung
9. Mittel zur Kompensation des Aufwandes
für Projektleiterinnen und Projektmitarbeite-
rinnen bei der
Geburt eines Kindes und in der Stillzeit
10. Differenzierte
Mindestquoten und Zielvorgaben für die Repräsentanz von
Wissen-schaftlerinnen in der
EU-Forschung
Gleichstellungsanforderungen an das deutsche
Wissenschaftssystem
11. Unbefristete Stellen für Frauen
in der Wissenschaft
12. Besetzung von
Leitungsfunktionen in der Forschung mit Frauen
13.
Höhere Forschungsanteile auf Stellen von
Wissenschaftlerinnen
14. Maßnahmen für frühe
Selbstständigkeit in der Forschung
15. Ernsthafte
Verpflichtung der Bundesländer und des Bundes zur Gleichstellung
von Frauen in der Wissenschaft.
16. Gender-Controlling und
Gender-Zielvorgaben in der deutschen Forschungsförderung
17.
Gezielte Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Wissenschaft und
Kindern auch für Frauen
in Deutschland
18.
Maßnahmen für Karrierepaare
19. Empowerment, Netzwerke
und Unterstützung für Frauen in der
Wissenschaft
Gestaltung der Information und Beratung zur
EU-Forschung für deutsche Wissenschaftlerinnen
20.
Benutzerinnenfreundliche Homepage
21. Wissenschaftskompatible,
zielgruppenorientierte schriftliche Informationen
22.
Zielgruppenorientierte Veranstaltungen mit individuellen
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern
23.
Kompetente Stellen für die Antragsberatung in räumlicher
Nähe sowie eine Lobby in Brüssel
24. Aufbau von
Netzwerken für Wissenschaftlerinnen in der EU-Forschung und
dauerhafte Etablierung einer Netzwerk-Stelle
25. Mentoring und
Coaching für Frauen in der EU-Forschung
Die
gesamte Studie kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden:
http://www.eubuero.de/arbeitsbereiche/fraueneuforschung/Links/Download/dat_/fil_561
Beiträge
Der
Deutsche Juristinnenbund geht in die Offensive und fordert endlich
Geschlechtergerechtigkeit bei den Tarifen der privaten
Versicherungswirtschaft. Die Forderungen der Juristinnen beziehen
sich auf die private Kranken- und Rentenversicherung. Folgende
Argumente sind hierfür ausschlaggebend:
Krankenversicherung
Der
djb fordert den Gesetzgeber auf, geschlechtsneutrale Beiträge in
der privaten Krankenversicherung gesetzlich vorzuschreiben. Dies
erscheint aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten. Art. 3
Abs. 3 GG verbietet jede Diskriminierung aufgrund des Geschlechts,
Abs. 2 S. 2 der Norm verpflichtet den Gesetzgeber, auf die
Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken. Rechtfertigungsgründe
für die höheren Krankenversicherungsbeiträge für
Frauen sind nicht zu erkennen.
1.
Die statistisch höhere Lebenserwartung von Frauen und die damit
verbundenen höheren Versicherungsleistungen rechtfertigen die
unterschiedlichen Beiträge schon deshalb nicht, weil die länger
lebenden Frauen auch länger Beiträge zahlen, mit denen die
Versicherungsleistungen abgedeckt sind.
Darüber
hinaus sind Frauen im Alter seltener krank und behandlungsbedürftig
als Männer, verursachen daher gerade in dieser Lebensphase
geringere Kosten.
2.
Die statistisch höhere Lebenserwartung von Frauen als
versicherungsmathematischer Faktor beruht darüber hinaus nicht
ausschlaggebend auf ihrem biologischen Geschlecht. Nach neueren
Untersuchungen spielen andere Faktoren wie Familienstand,
sozioökonomische Faktoren, Beschäftigung/ Arbeitslosigkeit,
Religion, Rauchen und Ernährungsgewohnheit eine wichtigere
Rolle. Das Geschlecht ist daher kein wirklich aussagekräftiger
Indikator für die Lebenserwartung, es ist lediglich gut
handhabbar für die Versicherungswirtschaft. Differenzierungen
aus Gründen der Praktikabilität sind grundgesetzlich jedoch
nicht zulässig.
3.
Die statistisch höheren Versicherungsleistungen für Frauen
beruhen auch auf den Kosten, die mit Schwangerschaft und Mutterschaft
verbunden sind. Die Zuweisung dieser Kosten über die höheren
Beiträge ausschließlich an Frauen wird nicht der
biologischen Tatsache gerecht, dass Männer ebenso wie Frauen an
der Entstehung dieser Kosten beteiligt sind.
4.
Darüber hinaus hat es die Versicherungswirtschaft bisher
versäumt offen zu legen, inwieweit sie solche, an das Geschlecht
anknüpfende Faktoren berücksichtigt und welche Auswirkungen
dies auf die Höhe der Beiträge hat. Deshalb kann z.B. der
Einwand der Versicherungswirtschaft, Schwangerschaftskosten
bestimmten die Beitragshöhe nur unwesentlich, nicht überprüft
werden. Überprüft werden kann insbesondere nicht, welche
Kosten die Versicherungswirtschaft zu den schwangerschaftsbedingten
Kosten rechnet. Auszuklammern aus dem Kostenvergleich zwischen Frauen
und Männern wären aber alle mit der sexuellen Beziehung
zwischen den Geschlechtern zusammenhängenden Kosten, angefangen
mit der durch die Verschreibungspflicht für die Pille
entstehenden Kosten über die ärztliche Betreuung der
Schwangeren bis hin zu nach der Entbindung notwendig werdenden
Behandlungen. Solange die Versicherungswirtschaft nicht zu der
geforderten Transparenz bereit ist, kann sie mit der bloßen
Behauptung der geringen Kosten-/Beitragsrelevanz nicht gehört
werden. Auch der Gesetzgeber kann keine sachgerechte Entscheidung
treffen, wenn er sich nicht ausreichend informieren lässt.
5.
Schließlich werden private Zusatzversicherungen zunehmend
notwendig, weil der Gesetzgeber Leistungen der gesetzlichen
Krankenversicherung kürzt. Das Abdrängen in private
Versicherungsverträge für Zusatzleistungen, die zuvor von
den gesetzlichen Krankenkassen mit geschlechtsneutralen Beiträgen
nach dem Solidaritätsprinzip erbracht wurden, darf nicht dazu
führen, dass nunmehr auch gesetzliche Krankenkassen wie die AOK
und Ersatzkassen für diese Zusatzleistungen
geschlechtsdifferenzierte Beiträge verlangen, wie der
Tagespresse zu entnehmen ist. Verfassungsrechtlich geboten ist
dagegen eine Regelung, die wie bei der privaten Pflegeversicherung
eine geschlechtsneutrale Beitragsgestaltung sicherstellt.
6.
Auch EU-rechtlich spricht alles für eine solche
Beitragsgestaltung. Die Annahme des Richtlinienvorschlags „ zur
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Frauen und
Männern beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern
und Dienstleistungen“ – KOM (2003) 657 endgültig –
durch die EU-Kommission beruht auf der eingehend begründeten
Erkenntnis, dass Handlungsbedarf des Gesetzgebers zu Einführung
von Unisex-Tarifen besteht, dem mehrere Mitgliedstaaten schon mit
entsprechenden gesetzlichen Regelungen nachgekommen sind.
Rentenversicherung
Der
djb fordert den Gesetzgeber auf, mit einem verfassungsrechtlich nach
Art. 3 Abs. 3 GG gebotenen privatrechtlichen Diskriminierungsverbot
dafür zu sorgen, dass Altersvorsorgeverträge bei gleichen
Beiträgen für Männer und Frauen auch zu gleichen
Leistungszusagen für beide Geschlechter führen. Auch ohne
ein solches Diskriminierungsverbot ist es verfassungsrechtlich sehr
bedenklich, Altersvorsorgeverträge steuerlich zu fördern,
die bei gleichen Beiträgen von Männern und Frauen
niedrigere Anwartschaften für Frauen auslösen. Der djb hat
entsprechend im Dezember 2000 in der öffentlichen Anhörung
des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung zur Einführung
der sog. Riester-Rente Stellung genommen.
Jetzt
geht die Bundesregierung berechtigt davon aus, dass die Akzeptanz der
steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge erhöht
werden muss. Die anstehende Änderung der Riester-Rente ist nach
Auffassung des djb der richtige Zeitpunkt und das geeignete
Gesetzesvorhaben, um das Gebot geschlechtsneutraler Tarifierung in
der privaten Altersvorsorge zu regeln. Die gesetzliche Änderung
ist verfassungsrechtlich erforderlich und erscheint europarechtlich
geboten.
1.
Die für die Forderung eines Diskriminierungsschutzes in der
privaten Zusatzversorgung entscheidende verfassungsrechtliche
Begründung ist, dass Art. 3 Abs. 2 GG einem Gesetzesvorhaben
entgegensteht, welches das Rentenniveau aller Versicherten absenkt
und für Frauen niedrigere Renten bei gleichen Beiträgen aus
der privaten Vorsorge erlaubt. Denn ein bisher formal
geschlechterneutrales solidarisches Alterssicherungssystem, das
bereits ein niedrigeres Versorgungsniveau für Frauen erbringt,
würde damit durch ein System teilweise abgelöst, das noch
schlechter für Frauen ist.
2.
Die bestehenden Nachteile der Beitragsäquivalenz werden in der
privaten Versicherung fortgeführt und noch erweitert, indem
Frauen aufgrund ihrer vorgeblich statistisch längeren
Lebenserwartung höhere Beiträge für die gleiche
Leistung erbringen müssen. Spätestens seit der Einfügung
von Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG ist der Staat jedoch verpflichtet auf
eine Beseitigung der bestehenden Nachteile für Frauen
hinzuwirken und darf kein System schaffen (lassen), das noch
schlechtere Leistungen für das bisher schon benachteiligte
Geschlecht zulässt.
3.
Die ersten Untersuchungen zeigen hochgerechnet auf das Jahr 2008,
wenn 4% des Entgelts im Rahmen der privaten Vorsorge gefördert
werden können, als Resultat des jetzigen Umstiegs in eine
private Altersvorsorge nicht akzeptable Verteilungswirkungen:
Mit
dem Umstieg in die private Vorsorge verschlechtert sich die
Situation für alle bis 1965 geborenen Frauen, d.h. alle Frauen,
die bis 2030 in Rente gehen. Für die ab Mitte der 50er Jahre
geborenen Männer kommt es zu leichten Verbesserungen.
Im
Vergleich zu Ehepaaren ohne Kinder verschlechtert sich die interne
Verzinsung für Ehepaare mit Kindern.
Vorteile
können insbesondere ledige Männer bei höherem
Einkommen ziehen.
4.
Zusätzlich gibt es wichtige Argumente dafür, dass
geschlechterdifferenzierende Tarife im Entgeltbereich EU-rechtswidrig
sind. Soweit im Rahmen der privaten Altersvorsorge von Unternehmen
unterschiedliche Leistungszusagen an Männer und Frauen gegeben
werden sollten, wäre dies mit Art. 141 Abs. 1 und 2 EG-Vertrag
unvereinbar. Dies wird dazu führen, dass Arbeitgeber ein nicht
geplantes Vorsorgevolumen finanzieren müssen, wenn der
Europäische Gerichtshof, wie zu erwarten ist, die
Unvereinbarkeit solcher Verträge mit dem europäischen Recht
feststellen wird. Ein vergleichbares Problem mit erheblichen
zusätzlichen finanziellen Lasten für die Unternehmen gab es
bei den Betriebsrenten von Teilzeitbeschäftigten. Eine
eindeutige Vorgabe des Gesetzgebers hätte die Risiken für
Unternehmen vermieden und könnte sie jetzt deutlich abmildern.
5.
Die Verpflichtung zu geschlechtergerechten Tarifen in der
Versicherungswirtschaft entspräche im Übrigen dem
europäischen Standard. Im Gemeinsamen Bericht der EG-Kommission
und des Rates über angemessene und nachhaltige Renten 2003 wird
berichtet, dass in den Niederlanden eine gesetzliche Bestimmung
eingeführt wurde, die ab 2005 gleiche Leistungen für Männer
und Frauen auch in beitragsdefinierten Systemen vorschreibt. In
Frankreich legen die Versicherer für die private Alterssicherung
Unisextarife zugrunde. Die EU-Kommission hat am 5. Dezember 2003 den
Richtlinienvorschlag KOM (2003) 657 endgültig angenommen, der
Unisextarife vorgeben will. Die europäische Entwicklung spricht
also dafür, die Kapitalisierung der Alterssicherung für
Deutschland von Beginn an auf der Basis von Unisexstarifen zu
stützen. Die deutsche Versicherungswirtschaft würde so
künftig europaweit konkurrenzfähige Produkte anbieten
können.
Aktuelles
aus der UzL
Umfrage zur Arbeitssituation von Ärztinnen und Ärzten in der Wissenschaft und Forschung an der Universität zu Lübeck: Die Auswertung
Imke
Krebs und Sabine Voigt
Im
Frühjahr 2003 wurde von der Medizinischen Fakultät der
Universität zu Lübeck in Zusammenarbeit mit der
Frauenbeauftragten eine Umfrage gestartet, die die Arbeitssituation
in Wissenschaft und Forschung von Ärztinnen und Ärzten
analysieren sollte. Ziel dieser Befragung war, die Hindernisse
während der Promotion und Habilitation von Ärztinnen und
Ärzten zu erfassen und daraus ableitend zukünftige
Maßnahmen zum Abbau möglicher Hürden zu entwickeln
und umzusetzen.
Insgesamt
wurden 711 Personen angeschrieben. Nach einer Erinnerung sind 385
Fragebögen zurückgekommen, was einem Rücklauf von 55%
entspricht.
Von den 380 beantworteten Fragebögen (5 missings), wurden 173
(45,5%) von Frauen und 207 (54,5%) von Männern beantwortet.
Die
Ärztinnen waren mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren um
3,5 Jahre jünger als ihre männlichen Kollegen (38,5).
Beruf
oder Familie ?
Hinsichtlich
des Familienstandes zeigt sich, dass Ärzte häufiger
verheiratet sind (65%) als Ärztinnen (44%). Hier wirkt sich
möglicherweise noch die Tradition aus, dass ein verheirateter
Arzt als belastbarer gilt (die Ehefrau als Entlastungsfaktor für
die Familie), während einer verheirateten Ärztin stets die
Doppelbelastung Beruf und Familie zugeschrieben wird.
Interessant
sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse zur Anzahl der Kinder:
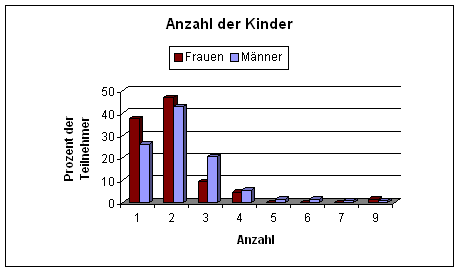
Von
den 173 befragten Frauen haben 109 keine Kinder. Das entspricht einer
Quote von 63%!
Von
den Ärztinnen mit Kindern, haben 38% ein Kind und 45% zwei
Kinder. Interessant wird es bei der Anzahl von drei Kindern: hier
haben Ärzte deutlich häufiger 3 Kinder (20%) als Ärztinnen
(8,5%).
Bei
der Frage, ob ihnen durch die Kinderbetreuung berufliche Nachteile
entstanden sind, haben nahezu 70% aller weiblichen Befragten mit „ja“
geantwortet, während nur 14% der männlichen Befragten diese
Frage bestätigten. Eine weitere Frage zu diesem Themenbereich,
die sich an alle Ärztinnen und Ärzte (mit und ohne Kinder)
richtete, lautete, ob sie glauben, dass ihnen durch Kinder
grundsätzlich berufliche Nachteile entstehen. Hier war das
Antwortverhalten noch deutlicher: 91,9% der Ärztinnen bejahten
die Frage gegenüber 35,1% ihrer männlichen Kollegen.
Dieses
Antwortverhalten könnte auch eine Erklärung für die
geringen Geburtenquoten bei Akademikerinnen sein, insbesondere bei
Wissenschaftlerinnen in den technischen und naturwissenschaftlichen
Fächern.
In
einer anderen bundesweiten Umfrage, die im Frühjahr 2001 bei den
weiblichen Mitgliedern der deutschen Physikalischen Gesellschaft
durchgeführt worden ist, kam heraus, dass von den insgesamt 3062
angeschriebenen Physikerinnen, 71% keine Kinder hatten.
Diese Zahlen belegen sehr eindrucksvoll, zumindest im akademischen
Bereich, die derzeitige Unvereinbarkeit von Beruf und Familie.
Die
berufliche und familiäre Doppelbelastung wird auch bei der Frage
nach Teilzeit- bzw. Vollzeitbeschäftigung deutlich. Nur ein Arzt
(5,4%) gab an, in Teilzeit beschäftigt zu sein gegenüber 52
der befragten Ärztinnen (30,6%).
Die Promotion – das ungenutzte
Potential
Ein
weiteres für die Fakultät interessantes Ergebnis ist, dass
65% der Befragten während ihrer Promotion in kein größeres
Forschungsprojekt eingebunden waren. Von den Doktoranden, die in
Forschungsprojekte eingebunden waren, waren doppelt so viele Männer
(84 (43%)) als Frauen (41 (23%)).
An
dieser Stelle muss die Frage gestellt werden, ob hier nicht
wissenschaftliche Kapazitäten vergeudet werden und ob zukünftig
eine effizientere und gezieltere Förderung von Promotionen
innerhalb von Forschungsprojekten nicht sowohl wissenschaftlich als
auch betriebswirtschaftlich sinnvoller wäre. Darüber hinaus
waren 25% mit der Betreuung der Promotion nicht zufrieden.
Insbesondere zu lange Korrekturzeiten, die die Doktorarbeiten unnötig
verzögerten, wurden hier als freie Antwortmöglichkeit am
häufigsten angegeben. Vor dem Hintergrund des neuen
Hochschulrahmengesetzes, das für die Fertigstellung einer
Doktorarbeit sehr klare Zeitvorgaben angibt, erscheint auch in diesem
Punkt ein dringender Handlungsbedarf. Hierbei könnte die neue
Promotionsordnung der Medizinischen Fakultät ein erster Schritt
hin zu einer effizienteren Nutzung der wissenschaftlichen Ergebnisse
von Promotionen sein.
Die Habilitation – ein
Auslaufmodell?
Was
sich bei der (Nicht)Einbindung der Promotion in Forschungsvorhaben
bereits ankündigt, setzt sich beim Antwortverhalten zur
Habilitation fort. Denn hier trennen sich die Wege der Ärztinnen
und Ärzte. Lediglich 13,5 % der Ärztinnen wollen sich
habilitieren, während sich 42% der Ärzte die Habilitation
anstreben. Allerdings zeigen die Antworten sowohl bei den Frauen als
auch bei den Männern Unsicherheiten: 37% der Ärztinnen und
35% der Ärzte haben die Frage, ob sie sich habilitieren wollen,
mit „vielleicht“ beantwortet. Mit anderen Worten, hier
ruht eine wissenschaftliches Potential, dass es noch zu motivieren
gilt.
Setzt
man diese Ergebnisse mit den Antworten zur Promotion ins Verhältnis,
dann ist zu vermuten, dass die Ärztinnen und Ärzte, die
bereits während der Promotion in eine Forschergruppe integriert
waren, auch motiviert sind, weiterhin wissenschaftlich zu arbeiten,
um schließlich zu habilitieren. Da Männer als Doktoranden
doppelt so häufig in Projekte eingebunden waren als Frauen,
verwundert die bisher noch geringe Habilitationsquote von Frauen
nicht.
Außerdem
ist auffällig, dass lediglich 26,5% aller Befragten angegeben
haben, ihre Habilitation habe einen inhaltlichen und/oder
methodischen Bezug zu der vorangegangenen Promotion. Deutlicher
ausgedrückt, 73,5% der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
haben sich mit Beginn ihrer Habilitation in ein völlig
inhaltlich und methodisch neues Gebiet eingearbeitet, und sich
praktisch erst zu diesem Zeitpunkt für ihren zukünftigen
wissenschaftlichen Schwerpunkt entschieden. Hierbei haben
geschlechtsspezifische Unterschiede im übrigen kaum eine
Bedeutung. Die Promotion in der Medizin spielt offensichtlich für
die zukünftige wissenschaftliche Spezialisierung und Laufbahn
eine äußerst geringe Rolle. Damit entscheiden sich
deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf dem Gebiet der
Medizin im internationalen Vergleich sehr spät für ein
wissenschaftliches Schwerpunktthema.
Ähnlich
wie bei der Promotion stellt sich der Zufriedenheitsfaktor beim
Verlauf der Habilitation dar. 28% waren damit unzufrieden und die
Gründe liegen hauptsächlich in der mangelnden Zeit, die
neben Krankenversorgung und Lehre kaum mehr Raum für Forschung
zulässt und in zu geringer Unterstützung. Dabei waren die
Wissenschaftlerinnen wesentlich unzufriedener als ihre männlichen
Kollegen, denn fast die Hälfte aller Habilitandinnen gaben an,
mit dem Verlauf der Habilitation unzufrieden zu sein.
So
ist es auch kaum verwunderlich, dass sich 56% der
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht während der
regulären Arbeitszeit ihrer Habilitation widmen konnten. Das
unter diesen Umständen Forschungsarbeiten nur zögerlich
vorankommen, erstaunt wenig. Doch dieses Phänomen betrifft nicht
nur Lübeck, sondern alle Medizinischen Fakultäten. Eine
Entzerrung des Dreiergestirns Forschung, Lehre und Krankenversorgung
könnte hier Lösungsansätze bieten, um in der Forschung
mittel- und langfristig auch der internationalen Konkurrenz stand zu
halten.
Denn
die interne Verteilung in Routinearbeit sprich Krankenversorgung auf
der einen Seite und Forschung auf der anderen ist nach Meinung von
90% der Befragten ohnehin nicht gleich verteilt. Das heißt,
inoffiziell scheint es bereits eine Aufgliederung des
wissenschaftlichen Personals für erstens Krankenversorgung und
zweitens Forschung zu geben. Und diese Aufgliederung, da sind sich
Männer und Frauen einig, ist geschlechtsspezifisch, denn 62%
meinten, dass Männer mehr Arbeitszeit für Forschung bei
gleicher Qualifikationsstufe investieren als in Krankenversorgung.
In
diese Richtung weisen auch die Antworten auf die Frage nach den
Voraussetzungen für eine wissenschaftliche Weiterqualifikation.
Hier gibt die überwiegende Mehrheit, nämlich 69%, eine
Freistellung von Routineaufgaben an. Auch in der Förderung durch
den Vorgesetzten sehen 60% eine wesentliche Voraussetzung für
eine wissenschaftliche Karriere. Ebenso beurteilen 51% längerfristige
Arbeitsverträge als einen Garanten für eine
wissenschaftliche Qualifikation, denn Verträge über
lediglich ein oder zwei Jahre bieten weder Planungssicherheit noch
Kontinuität für ein größeres Forschungsvorhaben.
Auf
die frei zu beantwortende Frage, welche Anforderungen die
Teilnehmenden an die Universität stellen würden, wenn sie
heute noch einmal promovieren bzw. habilitieren würden, ist das
Antwortverhalten eindeutig: Insbesondere für Promotionsarbeiten
wünschte sich die Mehrheit eine bessere Betreuung
(Qualitätsstandards) und klarere Strukturen. Ebenso eine bessere
Vermittlung von statistischen Grundlagen war ein häufig
genanntes Item. Einige beklagten auch den Umstand, dass die Promotion
in der Medizin in der Regel bereits neben dem Studium geschrieben
werde, was in den Augen vieler Befragter geradezu eine Abwertung der
Promotion sei. Um die Promotion wissenschaftlich aufzuwerten, seien,
wie auch in anderen Fächern üblich, Promotionszeiten nach
dem Studium einzurichten, während der man sich intensiv der
wissenschaftlichen Arbeit widmen könne.
Die
Juniorprofessur stößt bei den Befragten auf wenig
Akzeptanz. Die Mehrheit (71,2%) lehnte die Juniorprofessur als
Alternative zur Habilitation ab. Dabei zeigten sich die Ärztinnen
jedoch etwas aufgeschlossener: Immerhin konnten sich knapp 40% der
Ärztinnen eine Juniorprofessur als Alternative zur Habilitation
vorstellen gegenüber nur 24,7% der Ärzte.
Wissenschaftlerinnen und Ärztinnen
– noch nicht entdeckte Potentiale
Die
geringe Habilitationsquote bei den Ärztinnen spiegelt sich auch
in den sonstigen Forschungsaktivitäten wieder.
Hierbei
spielen beispielsweise die Besuche von Fachkongressen eine besondere
Rolle. Zwar besuchen Frauen wie Männer nahezu ähnlich oft
Kongresse, jedoch treten Männer wesentlich häufiger als
Referenten (71%) auf als Frauen (53%). Und diese Vortragshäufigkeit
steht in unmittelbarem Zusammenhang mit Publikationsaktivitäten.
Während
70,7% der befragten Ärzte in den vergangenen 2 Jahren publiziert
haben (Originalarbeiten), konnten hier nur 44,2% der Ärztinnen
die Frage mit ja beantworten. Auch bei der Antragstellung von
Drittmitteln ist die Quote bei den Männer mit 47,3% deutlich
höher als bei den Frauen (17,5%).
Die
Gründe hierfür reichen von mangelnder Unterstützung
bzw. Freistellung von der Krankenversorgung bis hin zum mangelnden
Interesse am wissenschaftlichen Arbeiten (26%). Gerade das Verfassen
von Publikationen oder Anträgen scheint für viele
problematisch (17%), da hierfür Zeit und vor allem Ruhe benötigt
wird, die im Klinikalltag so nicht vorhanden ist. Ist der private
Alltag dann noch von Kinderbetreuung geprägt, ist es
insbesondere für Ärztinnen schwer, sich weiterhin in der
Forschung zu engagieren. Unflexible Kinderbetreuungszeiten und zu
wenig Hort- und Krippenplätze tun ihr übriges. Nichts Neues
also!
Doch
nun gibt es Bestrebungen seitens der Medizinischen Fakultät,
zumindest Ärztinnen, die den Spagat zwischen Lehre,
Krankenversorgung und Forschung auf der einen Seite und Familie auf
der anderen zu erleichtern. Seit vergangenem Jahr wird über die
interne Forschungsförderung der Medizinischen Fakultät ein
Programm angeboten, dass sich zunächst speziell an Ärztinnen
mit Kindern richtet. Sie haben die Möglichkeit auf Antrag eine
6-12monatige Freistellung von der Krankenversorgung zu bekommen, um
ihr Habilitationsvorhaben zu beenden.
Nach Auswertung der Befragung ein lohnenswertes und von vielen
Befragten durchaus gefordertes Programm. Zumindest war es eine
wiederholt geäußerte Antwort auf die frei zu beantwortende
Fragen, welche Anregungen und Wünsche sie denn hätten, um
den Frauenanteil in der Wissenschaft und Forschung zu steigern.
Zusammenfassung
und Ausblick
Hinsichtlich
der Unvereinbarkeit von wissenschaftlicher Karriere und Familie hat
die Umfrage an der Universität zu Lübeck letztlich die
Ergebnisse von ähnlichen Umfragen in Göttingen
und Berlin
bestätigt. Noch immer lasten mehrheitlich die familiären
Verpflichtungen auf den Schultern der Frauen, was sich insbesondere
während der medizinischen Weiterbildung und der
wissenschaftlichen Qualifizierungsphase ungünstig auf die
Karriereverläufe von Ärztinnen auswirkt. Und die meisten
Ärztinnen haben nach der vorliegenden Umfrage ihre Kinder
während der Facharztweiterbildung bekommen. Mangelnde
Kinderbetreuung und unflexible Öffnungszeiten der
Kinderbetreuungseinrichtungen erschweren nach Angaben der Befragten
entscheidend die weitere berufliche Entwicklung von Frauen. Dies wird
auch geradezu gebetsmühlenartig von bundesweiten Studien immer
wieder bestätigt. Trotz dieser erwiesenen Defizite erscheinen
politische Entscheidungen und vor allem deren Umsetzungen in weiter
Ferne. Allein immer wieder beschworene Absichtserklärungen
seitens des Bundesfamilienministeriums reichen eben nicht, um in
dieser Frage eine Trendwende einzuläuten.
Vor
diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll und richtig, dass die
Universität zu Lübeck zumindest bei der Nachwuchsförderung
einen Schwerpunkt auf die Qualifizierung von wissenschaftlich
engagierten Ärztinnen mit Kindern gesetzt hat.
Ein
weiteres wichtiges Ergebnis dieser Umfrage ist die viel zu geringe
Einbindung von Doktoranden insbesondere von Doktorandinnen in
Forschungsprojekte. Dabei hätte die stärkere Nutzung von
Promotionen für Forschungsschwerpunkte für alle Beteiligten
nur Vorteile:
Eine
intensivere Einbindung von DoktorandInnen hat in der Regel eine
bessere Betreuung zur Folge.
Die
zielgerichtete Einsetzung von Promotionsthemen bedeutet einen
zielgerichteten Einsatz von Materialien (z.B. Reagenzien, Rohstoffe
etc.) und ist damit kostensparend.
Ist
eine Promotion teil eines Forschungsprojektes, erhöht dies in
der Regel auch die Qualität der Promotionsarbeit.
Für
wissenschaftlich engagierte DoktorandInnen eröffnet sich früher
die Möglichkeit, für sich einen wissenschaftlichen
Schwerpunkt zu definieren und diesen kontinuierlich für eine
Habilitation auszubauen. Eine frühe wissenschaftliche
Profilierung würde sich insbesondere für Frauen günstig
auf den Karriereverlauf auswirken.
Wissenschaftliche
Kontinuität ist schließlich auch eine der Voraussetzungen
für wissenschaftliche Spitzenleistungen.
Mit
der Etablierung der neuen Promotionsordnung ist sicherlich ein
erster, wichtiger Schritt getan worden, sich dieser Problematik
anzunehmen.
Für
die weitere wissenschaftliche Qualifizierung war für die meisten
Befragten die Freistellung von der Krankenversorgung die wichtigste
Voraussetzung und zwar sowohl für Ärzte als auch für
Ärztinnen. Ein Vorschlag einer Befragten war, ein verbindliches
Curriculum für wissenschaftlich engagierte Ärzte und
Ärztinnen zu erstellen, in dem Freistellungen von der
Krankenversorgung geregelt werden.
Anhang: Allgemeine
Fragen
Für
wie wichtig halten Sie folgende Aspekte für Ihre Arbeit?
(Angaben
in Prozent)
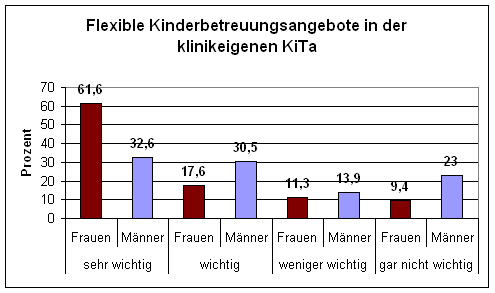
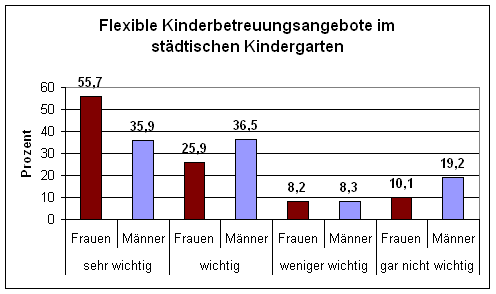
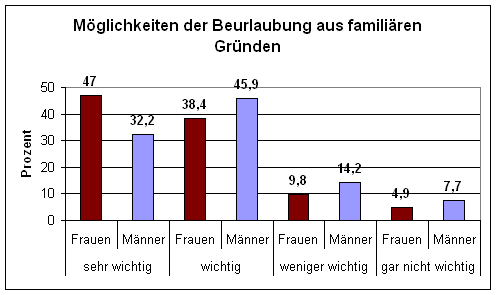
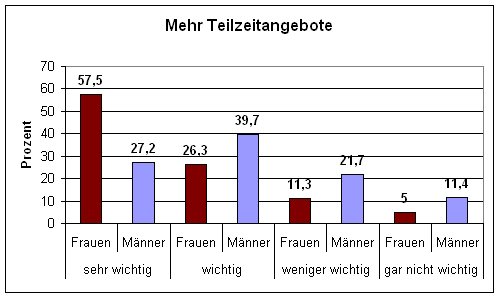
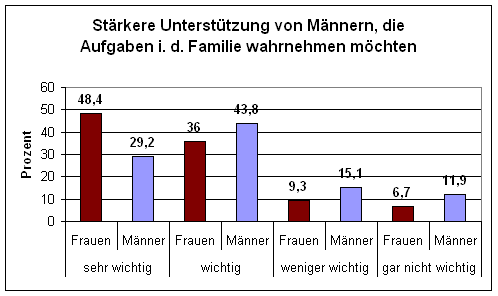
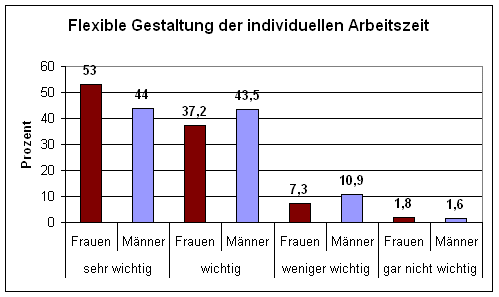
An der Medizinischen Fakultät/Klinikum sind Frauen
in den gehobenen/leitenden Positionen unterrepräsentiert. Welche
Gründe kämen Ihrerseits hierfür in Frage [Angaben
in Prozent]?
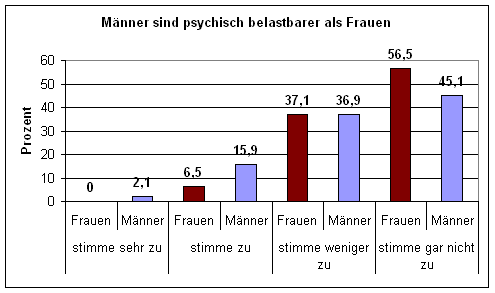
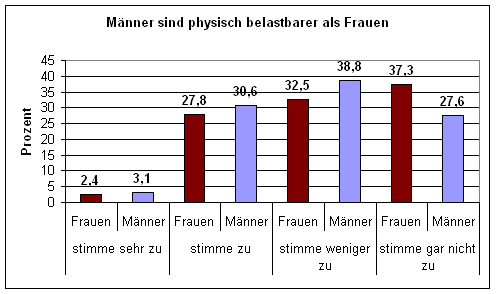
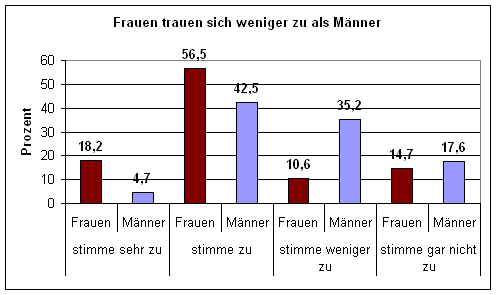
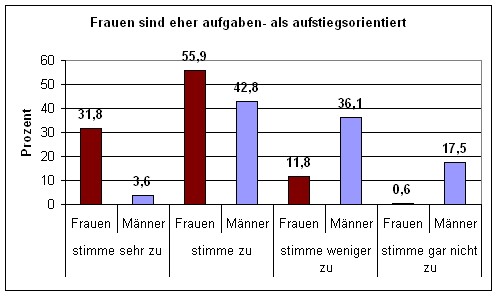
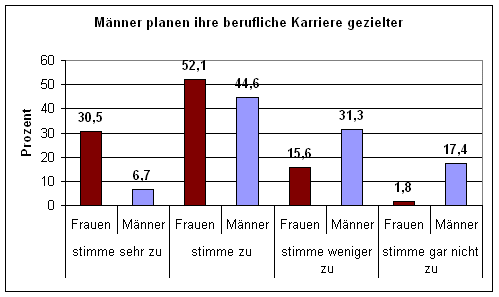
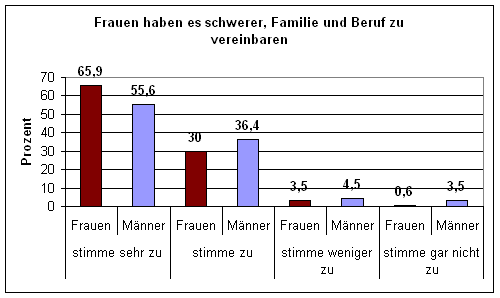
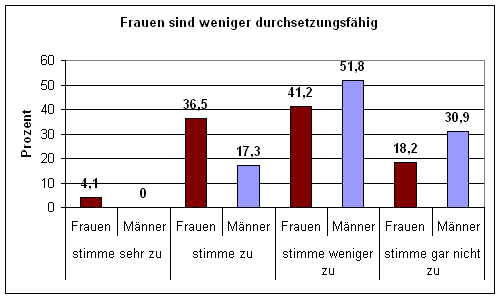
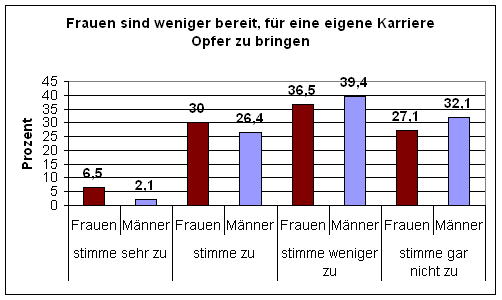
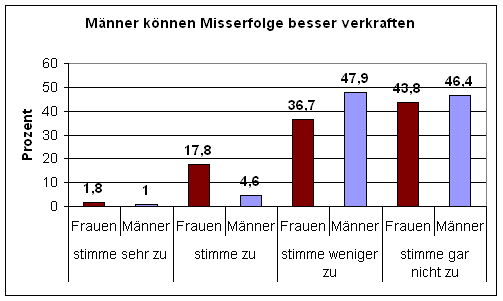
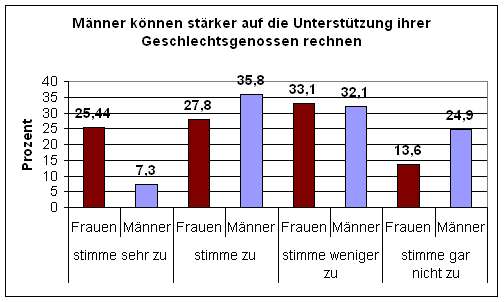
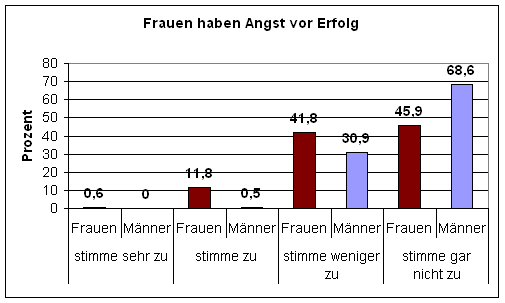
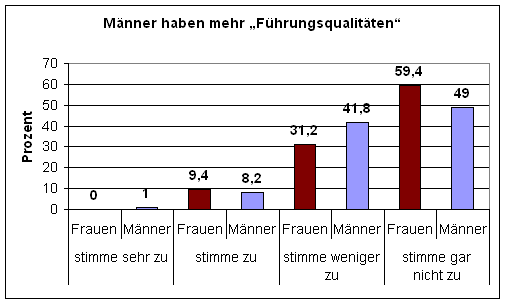
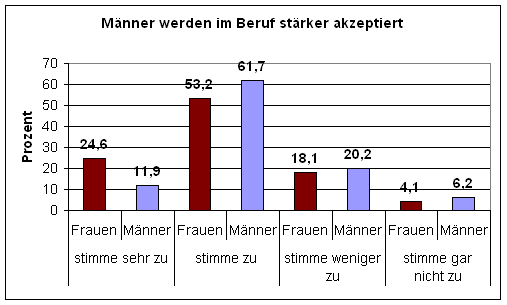
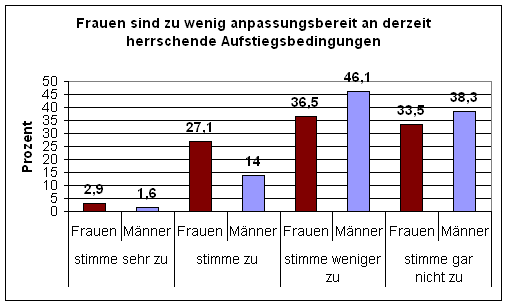
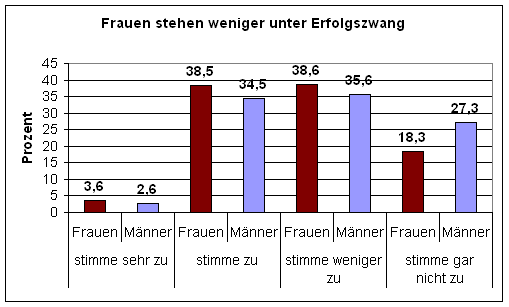
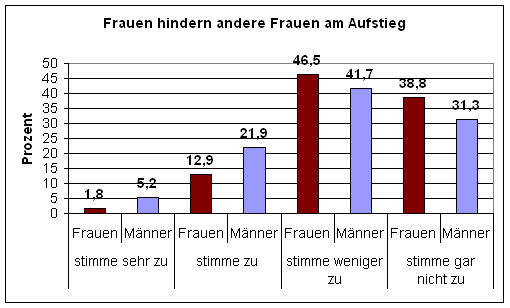
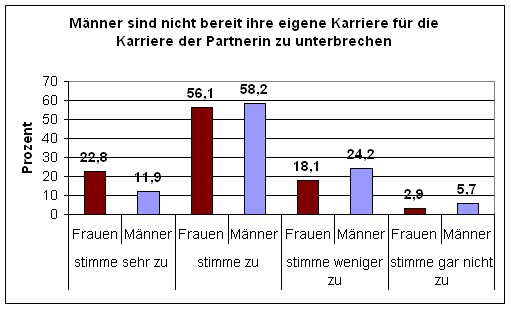
Aktuelles
aus der UzL
Zur
Förderung von Unternehmensgründungen aus Hochschulen hat
das Bundesministerium für Bildung und Forschung das Programm
„EXIST- Existenzgründungen aus Hochschulen aufgelegt. Zu
den EXIST-Existenzgründungsnetzwerken gehört auch KOGGE,
welches die Gründungsaktivitäten aus der Wissenschaft für
den Raum Schleswig-Holstein koordiniert.
Ein
Projekt dieses Programms ist das Servicezentrum für
Existenzgründerinnen aus Lübecker Hochschulen, kurz deluex
genannt, das die Universität zu Lübeck bereits im Mai 2003
offiziell eröffnet hat.
Forschungsergebnisse
zum Thema Existenzgründungen zeigen, dass das unternehmerische
Potenzial von Frauen lange nicht ausgeschöpft ist. In
Deutschland wie in anderen Ländern, gründen Frauen seltener
als Männer. Hierzulande liegt der Anteil der weiblichen
Selbständigen bei nur 27%. Damit belegt die Bundesrepublik im
europäischen Vergleich lediglich Rang 11.
Vor
allem bei Existenzgründungen aus den Hochschulen sind
Wissenschaftlerinnen kaum vertreten, wie die Exist-Begleitforschung
gezeigt hat. Von 5300 Studierenden (davon 45% Studentinnen) an zehn
Hochschulen haben sich nur 9% der Befragten nachdrücklich für
eine Existenzgründung oder Ausgründung interessiert. Davon
waren 75% Männer.
Vor
diesem Hintergrund hat sich das deluex-Servicezentrum die
frauenspezifische Beratung und Qualifizierung rund um die Themen der
beruflichen Selbständigkeit sowie die Förderung der
Kommunikation und des Erfahrungsaustausches zum Ziel gesetzt.
Das
deluex- Servicezentrum bietet individuelle Beratung zur
Konkretisierung einer Geschäftsidee, monatliche Vorträge,
Seminare und Workshops zu fachspezifischen Themen und stellt
technische Hilfsmittel für die eigene Recherche zur Verfügung.
Besucherinnen steht kostenloses Informationsmaterial zu allen
relevanten Themenbereichen der Existenzgründung und eine
Handbibliothek mit Fachliteratur zur Verfügung.
Im
ersten Jahr des Bestehens nutzten bereits 69 Frauen das Angebot des
Servicezentrums. Mehrere Frauen befinden sich auf dem Weg zur
Gründung einer Voll- oder Teilzeitselbständigkeit. Die
Initiatorin des Unternehmens DermaFocus GmbH, gegründet am 1.
Oktober 2003, nahm als eine der ersten Frauen das Beratungsangebot
des deluex-Servicezentrums in Anspruch und wurde auf dem Weg zur
Gründung begleitet.
Wer
mehr über das deluex - Servicezentrum für
Existenzgründerinnen aus Lübecker Hochschulen erfahren
möchte oder plant, sich selbständig zu machen, kann sich an
Frau Anke Jacobs, Tel. 0451/500-4476, Email:
jacobs@zuv.uni-luebeck.de,
wenden oder unsere Homepage www.deluex.uni-luebeck.de
mit dem aktuellen Veranstaltungskalender für 2004 besuchen.
Sie
finden deluex auf dem Lübecker Uni-Campus im Haus 154, in den
Räumen der Frauenbeauftragten.
News
Familie und Beruf sind in Deutschland immer noch schwer zu vereinbaren
Frauen
mit Kindern in Frankreich sind häufiger berufstätig als
deutsche Frauen, und dies, obwohl Französinnen häufiger
Mütter sind und auch mehr Kinder haben. So gingen im Jahr 2000
in Frankreich 68 Prozent der Mütter einer Beschäftigung
nach, während dieser Anteil in Deutschland nur bei 57 Prozent
liegt.
Besonders
groß ist der Unterschied zwischen beiden Ländern für
Mütter mit Kindern im Alter von bis zu sechs Jahren: Nur 36
Prozent der deutschen Frauen mit mindestens einem Kind unter sechs
Jahren sind erwerbstätig, in Frankreich hingegen 59 Prozent. Das
zeigen Auswertungen repräsentativer Datensätze im Zentrum
für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim.
Eine
Erklärung für die höhere Erwerbstätigkeit bei
größerem Kinderreichtum in Frankreich ist die im Vergleich
zu Deutschland anders strukturierte Familienpolitik. Die französische
Familienpolitik verfolgt traditionell das Ziel, die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie zu gewährleisten. Dies spiegelt sich
beispielsweise in einem flächendeckenden Netz an staatlichen
Kinderbetreuungsangeboten wider. In Deutschland hingegen konzentriert
sich die Familienpolitik vorrangig auf die finanzielle Würdigung
der Erziehungstätigkeit, beispielsweise durch Bundes- und
Landeserziehungsgeld. Wie wichtig gut ausgebaute staatliche
Kinderbetreuungsangebote sind, zeigt auch ein Vergleich von
berufstätigen Müttern in West- und Ostdeutschland. Hierbei
zeigt sich, dass sich ostdeutsche Frauen mit Kindern ähnlich wie
die Französinnen verhalten: Sie sind wesentlich häufiger
berufstätig. So gehen etwa in Westdeutschland nur 15 Prozent der
Mütter einer Vollzeitbeschäftigung nach, in Ostdeutschland
dagegen 42 Prozent. Es liegt nahe, dies auf die nach wie vor bessere
Kinderbetreuungssituation in Ostdeutschland, insbesondere auch
ganztags und für Kleinkinder, zurückzuführen.
Als
unzutreffend entpuppt sich für Deutschland die oft geäußerte
Behauptung, dass Frauen mit höherer Schulbildung weniger Kinder
bekommen als Frauen mit geringerer Schulbildung. Vielmehr werden
höher qualifizierte deutsche Frauen heute später Mutter.
Dagegen zeigt sich in Frankreich durchaus ein Zusammenhang zwischen
Bildungsniveau und Geburtenzahl. Für beide Länder gilt
indes, dass junge Mütter nach der Geburt eines Kindes umso
häufiger wieder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, je höher
ihre Bildung ist.
Download
der Studie:
ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp0350.pdf
News
Eine
ausführliche Datenbank zum Thema Frauengesundheit hat die
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) ins
Netz gestellt.
Die
Sammlung gliedert sich in sechs Themenbereiche:
Gesundheit
Reproduktive
Gesundheit
Lebenssituation
Krankheit
Soziale
Faktoren
Politik.
Jeder
Bereich teilt sich wiederum in Einzelthemen bzw. Indikatoren auf,
insgesamt 26. Unter dem Thema Lebenssituation gibt es beispielsweise
Daten zu Alkoholmissbrauch, illegalen Drogen, Suchtprävention,
Behinderung sowie Ernährung. Zu jedem einzelnen Indikator sind
Literatur, Datensammlungen bzw. Statistiken, Organisationen und
weiterführende Links zusammen getragen. Die Informationen sind
je nach Thema für die Region Deutschland, Europa, USA oder
International erhältlich, wobei es sich überwiegend um
bibliographische Angaben handelt. Seltener können sich
Nutzerinnen eine Kurzfassung herunterladen. Derzeit umfasst die
Sammlung etwa 2000 Einträge, die kontinuierlich aktualisiert
werden. Aufbau und Inhalt der Datenbank entspricht dem
interdisziplinären und integrativen Ansatz in der
Frauengesundheitsforschung.
Zusammenfassend
eine gut aufgebaute Internetseite, auf der es viel Neues über
Frauengesundheit und –krankheit zu entdecken gibt.
Weitere
Informationen:
www.bzga.de/frauengesundheit
News
Statistisches Bundesamt stellt neue Hochschuldaten vor
Im
Dezember 2003 wurden in Berlin aktuelle Ergebnisse der
Studierendenstatistik sowie ausgewählte Strukturdaten der
Hochschulstatistiken vorgestellt.
Nach
ersten vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes
haben sich im gerade begonnenen Wintersemester 2003/2004 an den
Hochschulen in Deutschland fast 2,026 Mill. Studierende
eingeschrieben, so viele wie nie zuvor. Gegenüber dem Vorjahr
(1,939 Mill. Studierende) waren dies fast 87 000 Studierende mehr (+
4,5%). Damit sind nun erstmals mehr als 2 Mill. Studierende in
Deutschland immatrikuliert.
Im
Wintersemester 2003/2004 studieren 1,438 Mill. (71%) Frauen und
Männer an Universitäten oder vergleichbaren Hochschulen,
555 000 (27%) an Fach- oder Verwaltungsfachhochschulen und 32 000
(2%) an Kunsthochschulen. Der Anteil der Frauen an den Studierenden
blieb im Vergleich zum vorangegangenen Wintersemester 2002/2003
unverändert bei 47,4%. In den Jahren zuvor war dieser Anteil
kontinuierlich gestiegen.
Auch
die Zahl der Studienanfänger erreichte im Studienjahr 2003/2004
(Sommersemester 2003 und Wintersemester 2003/2004) mit rund 385 000
(+ 7% zum Vorjahr) einen neuen Höchststand. Unter den
Studienanfängern sind knapp 186 000 Frauen. Nachdem im
Studienjahr 2002/2003 erstmals mehr Frauen als Männer ein
Hochschulstudium begonnen hatten, liegt der Frauenanteil bei den
Studienanfängern im aktuellen Studienjahr bei 48%.
Nach
ersten vorläufigen Ergebnissen liegt die Studienanfängerquote,
d.h. der Anteil der Studienanfänger an der gleichaltrigen
Bevölkerung, für das Studienjahr 2003/2004 bei 39,6%. Im
Vorjahr hatte sie noch 37,1% betragen. Damit setzt sich der in den
vergangenen zehn Jahren zu beobachtende Anstieg weiter fort.
Gegenüber 1993 (25,5%) hat sich die Studienanfängerquote um
14 Prozentpunkte erhöht. In den Jahren 1999 bis 2002 war die
Quote bei den Frauen jeweils höher als bei den Männern. Mit
40,1% fällt sie bei den Männern nun wieder etwas höher
aus als bei den Frauen (39,1%).
Im
Studienbereich Informatik nahmen ersten Ergebnissen zufolge im
Studienjahr 2003/2004 gut 33.600 Studierende im ersten Fachsemester
ihr Fachstudium auf. Nach einem sprunghaften Anstieg in der zweiten
Hälfte der 1990er Jahre und einem seit 2000 anhaltenden Rückgang
nahmen die Neueinschreibungen in Informatik somit wieder zu (+ 3,5%
zum Vorjahr).
Fast
33 500 Studierende begannen im Studienjahr 2003/2004 ein Fachstudium
im Studienbereich Maschinenbau/Verfahrenstechnik, 8% mehr als im Jahr
zuvor. Der seit 1998 in diesem Studienbereich zu beobachtende Anstieg
hält damit auch im sechsten Jahr in Folge an. Die Zahl der
Studierenden im ersten Fachsemester im Studienbereich Elektrotechnik
beträgt rund 17 300, das sind 3% weniger als im Jahr zuvor. Der
Anstieg seit Mitte der 1990er Jahre ist damit zunächst beendet.
Dagegen nahmen im Studienjahr 2003/2004 mit knapp 8 700 zum zweiten
Mal in Folge mehr Studierende ein Fachstudium im Bereich
Bauingenieurwesen auf (+ 7% gegenüber dem Vorjahr).
Auch
beim Frauenanteil gibt es weiter deutliche Unterschiede zwischen den
Studienbereichen: Im Bereich Bauingenieurwesen sind – bei
steigender Tendenz – bereits mehr als ein Viertel (26%) der
Studierenden im ersten Fachsemester Frauen. In den Studienbereichen
Elektrotechnik (9%), Maschinenbau/ Verfahrenstechnik (17%) und
Informatik (17%) ist die Frauenbeteiligung deutlich geringer.
Weitere
Informationen:
http://www.destatis.de/presse/deutsch/pm2003/p4920071.htm
News
Die
Deutsche Forschungsgemeinschaft bietet momentan vor allem
Nachwuchswissenschaftlern durch sogenannte „portable“
Förderangebote die Möglichkeit, in der Nähe des
Partners zu arbeiten. Dies gilt insbesondere für die
Stipendienprogramme, das Förderangebot „Eigene Stelle“
sowie unter bestimmten Voraussetzungen auch für das
Emmy-Noether-Programm. Darüber hinaus trägt sie in ihrem
Förderangebot den besonderen Anforderungen Rechnung, die sich
für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellen, die Beruf
und Familie vereinbaren möchten. So ermöglichen
DFG-Stipendien, die Arbeitszeit aus familienbedingten Gründen
für einen der Elternteile auf bis zu 50 Prozent zu verringern.
Dementsprechend verlängert sich die Förderlaufzeit. Ferner
erhöhen sich Auslandszuschläge bei Begleitung durch den
Ehepartner oder Kinder und die DFG zahlt Fahrtkosten sowie Zuschüsse
zu Rück-Umzugskosten für die ganze Familie bei längeren
Auslandsaufenthalten. In Programmen, in denen es Altersgrenzen gibt,
werden Familienzeiten selbstverständlich berücksichtigt.
Spätestens
die gemeinsame Tagung von DFG und Stifterverband hat gezeigt, dass
die Themen „Förderung von Doppelkarriere-Paaren in der
Wissenschaft“ sowie „Vereinbarkeit von Familie und
Wissenschaft als Beruf“ wichtige Bausteine sind, um tatsächlich
hochqualifizierte Forscherinnen und Forscher für eine Karriere
in Forschung und Lehre zu gewinnen. Das Presse-Echo zur Tagung hat
unter Beweis gestellt, welch großes Interesse auch in
Deutschland an diesen Zusammenhängen besteht. Viel zu tun bleibt
allerdings noch, wenn es um die Verwirklichung von Maßnahmen
geht, mit denen Hochschulen und Forschungseinrichtungen
Wissenschaftler-Paaren Berufswege ebnen und generell das Leben
erleichtern könnten. Da nicht nur Deutschland vor dieser
Herausforderung steht, empfehlen sich in diesem Zusammenhang auch
gemeinsame europäische Aktivitäten.
Impressum:
Herausgeberin:
Die
Frauenbeauftragte
Universität zu Lübeck
Ratzeburger
Allee 160
23538 Lübeck
e-Mail:
voigts@medinf.uni-luebeck.de
Druck:
Universität zu Lübeck
|